
Wie sich Leser leichter auf Figuren einlassen können
»So ist sie nicht! Du lässt dich nicht auf meine Figur ein.« Diesen Vorwurf durfte ich mir einmal von einer Autorin anhören, deren Thriller ich als Testleserin begleitete. Ich gebe zu, er hat mich getroffen, denn ich bilde mir ein, mich sehr gut auf Figuren einlassen zu können. Auf Figuren, die ich liebe, die ich hasse, die mir entsprechen oder die mir komplett fremd sind. Der Vorwurf muss mich ziemlich beschäftigt haben, denn als ich am nächsten Morgen aufwachte, kam die Erkenntnis wie ein Blitz: Mist, genau das werfe ich auch meinen Testlesern gerne vor!
Was hat es damit auf sich? Sind wir wirklich nicht in der Lage, Figuren unabhängig von unseren eigenen Erfahrungen zu sehen? Wollen wir ihnen als Leser unsere eigenen Vorlieben und Gedankengänge aufzwingen? Und vor allem, was heißt das für dich als Autorin?
Inhalt
Leser können sich nur auf Figuren einlassen, die du ihnen vollständig zeigst
Nicht immer liegt das Versäumnis bei den Lesern. Bist du überhaupt sicher, dass sie über alle notwendigen Informationen verfügen? Dass du ihnen die Figur auch tatsächlich in all ihren Facetten zeigst? Für uns Autorinnen ist das Verhalten einer Figur selbstverständlich, wir kennen sie ja von innen und außen. Und egal, wie sehr wir versuchen, uns selbst aus der Figur rauszuhalten, es wird uns nie hundertprozentig gelingen. Genau deshalb ist Kritik an unseren Figuren so schmerzhaft, denn irgendwie trifft sie ja auch uns als Person.
Die Leser sind aber nicht du
Deine Leser ticken allerdings in etlichen Punkten ganz anders als du oder deine Figur. Sie würden einen Widersacher vielleicht nicht anschreien, sondern sich geknickt ins hinterste Eck verkrümeln. Sie kaschieren Unsicherheit vielleicht durch saloppe oder besonders derbe Sprüche. Was in deiner Gedankenwelt vollkommen logisch ist, ist für sie im günstigsten Fall konfus, im schlimmsten schlichtweg bescheuert. Wie sollen sie nun die Handlungen einer Figur verstehen, die ihnen vollkommen fremd ist?
Zieh einen Rahmen auf, damit Leser sich auf die Figuren einlassen können
Leser, die nur sich selbst in einem Roman wiederfinden wollen, kannst du ohnehin nur durch einen Glückstreffer zufriedenstellen. Die anderen, die empathischen, die sich mit einer Figur identifizieren wollen, werden jedoch immer versuchen, in sie hineinzuschlüpfen. Wenn sie aber glauben, sich in Asterix zu befinden, obwohl du Obelix schreibst, müssen sie Obelix’ Handlungen als falsch empfinden. Mach ihnen also von vornherein klar, in wen sie da gerade eintauchen.
1. Gib Figuren ein Körpergefühl
Damit meine ich keine endlosen Beschreibungen. Schlüpfe selbst in deine Figur und erlebe die Welt durch sie. Kleine, zierliche Menschen nehmen die Umgebung und ihre Mitspieler anders wahr als große, das beginnt schon beim Blickwinkel. Ist die Figur energisch? Dann bewegt sie sich in einer Gruppe viel selbstbewusster als der schüchterne Typ. Ist sie raumfüllend? Spüre ihren Gang, das Tempo und die Größe ihrer Gesten. Wie viel Platz beansprucht sie für sich?
Beschreibe nicht, wie die Welt deine Figur sieht.
Zeige, wie deine Figur die Welt wahrnimmt.
2. Lass die Figur sprechen
Gibt ihre Sprache ihren Charakter wieder? Achte dabei vor allem auch auf die Gedankenrede. Man passt sich oft in der direkten Rede an sein Umfeld an, aber selten in seinen Gedanken. Ist die Figur schüchtern oder verklemmt? Dann wird sie nicht auf einmal verwegen denken. Ist sie der schnoddrige Kumpeltyp? Inszeniert sie sich als Vamp? Dann lass sie auch so denken.
3. Zeig die Figur in ihrem normalen Umfeld
In Ausnahmesituationen ist wohl jeder versucht, sich zu verstellen. Authentisch sind wir dann, wenn wir uns wohlfühlen oder ein Umfeld gut kennen. Das gilt ebenfalls für Figuren. Findet beim Lesen der erste Kontakt mit der Figur in einer Ausnahmesituation statt, dann lass sie sich selbst über ihr ungewohntes Verhalten Rechenschaft ablegen.
4. Für den ersten Eindruck gibt es keine zweite Chance
Was im täglichen Leben eine Binsenweisheit ist, trifft genauso auf deine Figuren zu. Achte daher ganz besonders darauf, welches Bild du deinen Lesern beim ersten Auftritt der Figur vermittelst. Das kann optisch sein, das kann die Reaktion auf ein Ereignis sein oder ihr Verhalten in einem bestimmten Umfeld.
5. Mach Widersprüche plausibel
Natürlich kann ein falscher erster Eindruck dramaturgisch durchaus gewollt sein. Dann solltest du aber nachher nicht einfach den Schalter umlegen, sondern das Bild sehr bewusst geraderücken. Und zwar so, dass wir merken, hoppla, so ist sie ja wirklich! Dazu schaffst du am besten Kontraste. Kontraste im Tempo, im Dramafaktor, im Milieu. Kontraste, die nicht nur die Figur spürt, sondern vor allem wir selbst beim Lesen.
6. Zieh die Charaktereigenschaften durch
Einmal angenommen, deine Figur ist anlehnungsbedürftig und sucht eine starke Schulter. In welchen Situationen wird sie das tun? Die starke Schulter kann der Lover/die Geliebte ebenfalls bieten wie die Eltern oder die beste Freundin. Wenn die Eigenschaft wesentlich ist, aber der/die Richtige erst auftauchen muss, um sie auszuleben, dann lass deine Figur sich nach solch einer Person oder Situation sehnen und zeige ihr Defizit auf.
Entscheide dich für Kerneigenschaften, die immer wieder zum Tragen kommen. Solche Kerneigenschaften sind grundlegender Bestandteil einer komplexen Figur.
7. Wonach sehnt sich deine Figur?
Nein, gib jetzt nicht sofort die Antwort! Frag dich lieber, wie sich diese Sehnsucht in ihren Handlungen und Dialogen zeigt. Unsere anhängliche Figur könnte schusselig werden, das Weibchen- oder Underdogschema bedienen. Oder Entscheidungen vermeiden. Vielleicht trifft sie ja trotzdem eine, weil sie einfach nicht auskommt. Dann lass sie diese Entscheidung mit Vertrauten reflektieren und zu Hause ihrem Ehegespons die Ohren volljammern, bis sie verständnisvoll in den Arm genommen wird. Das gilt übrigens für weibliche Figuren genauso wie für männliche.
Dreh den Spieß um und geh auf Distanz
Sieh dir die bereits geschriebenen Handlungen und Dialoge kritisch an. Aber bitte erst bei der Überarbeitung, sonst fällst du mir nämlich aus dem Schreibfluss. Schlüpf selbst in die Rolle eines neutralen Beobachters und versuche, das Verhalten zu interpretieren. Was siehst du? Was leitest du daraus ab?
Nähere dich deiner Figur wie eine Fremde
Das gilt auch für ihre Gedanken. Vergiss einmal, dass du die Figur kennst, gib ihr bei deinem Test einen anderen Namen. Hör ihren Reden und Gedanken zu und notiere dir, welches Bild daraus für dich entsteht. Was hieltest du von deinen Freunden, wenn sie solche Gedanken äußerten? Diesen Test mach bitte auch erst nach dem ersten Entwurf, denn während des Schreibens solltest du deine Figur unbedingt fühlen.
Gleiche Selbstbild und Fremdbild ab
Frag schließlich deine Testleser, an welchen Stellen genau der in deinen Augen falsche Eindruck entstanden ist. Woraus sie ihn ableiten. Piesacke sie ruhig, dafür sind Testleser da. Es reicht nämlich nicht zu wissen, dass eine Figur anders ankommt, als du willst, du musst wissen, warum, damit du nachjustieren kannst.
Bei aller kritischen Überpfrüfung vergiss eines nie: Am Ende bist immer du Herrin über deine Figur. Lass dich von (Test)lesern nicht dazu verleiten, eine Figur zu ändern, nur weil sie ihnen so besser gefallen würde oder sie ein anderes Verhalten schlüssiger finden. Aber achte sehr genau darauf, wo und warum falsche Eindrücke entstehen. Denn Leser können sich nur auf das einlassen, was du ihnen lieferst.
Oft scheitert es nicht am guten Willen, wenn man sich nicht auf deine Figuren einlässt und sie falsch interpretiert. Du selbst hast es in der Hand, ob Leser sich überhaupt auf sie einlassen können.


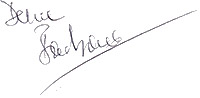


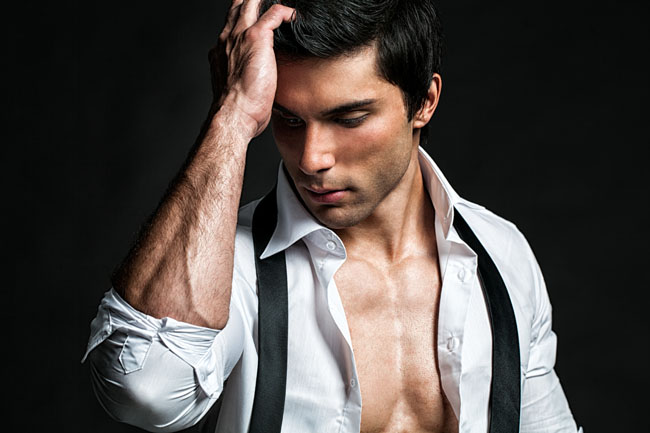


Ein guter Beitrag, hilfreich, weil rund. Mit „Der Leser bist nicht du“ ist alles auf den Punkt gebracht.
Das freut mich! Herzlichen Dank 🙂
Gerne – war ein Vergnügen, den Beitrag zu lesen.
Hallo,
Die Tipps gefallen mir gut! Vielen Dank! Ich werd mein aktuelles Skript einmal darauf prüfen 🙂
lg
Daniela
Liebe Daniela,
Fein, das freut mich 🙂 Viel Spaß beim Skriptprüfen und mit deinen Figuren!
Liebe Grüße
Barbara